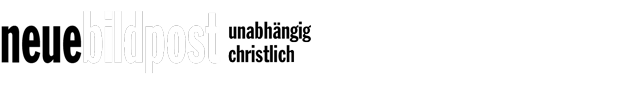Ob in der Südsee, in den USA, bei den Katholiken Asiens oder in Europa: Die Augen der christlichen Welt sind nach Rom gerichtet, wo in wenigen Tagen die Weltsynode beginnt. Insbesondere die Erwartungen in Deutschland, wo viele Gläubige vehement auf Reformen drängen, sind groß. Weltkirchenbischof Bertram Meier, Oberhirte des Bistums Augsburg, erläutert im Interview Erwartungen und Hoffnungen.
Herr Bischof, Sie sind bei der am 4. Oktober beginnenden Versammlung als einer der drei gewählten deutschen Vertreter erstmals Teilnehmer einer Bischofssynode in Rom – dort haben Sie lange im Vatikan gearbeitet. Freuen Sie sich, nun ein paar Wochen dorthin zurückzukehren? Was bewegt Sie im Vorfeld am meisten?
Zunächst eine Klarstellung: Die Synode beginnt schon drei Tage früher mit einer ökumenischen Gebetsvigil und Besinnungstagen außerhalb von Rom. Mit dieser Ouvertüre intoniert Papst Franziskus die Synode als spirituelles Ereignis. Für mich ist die Synode gewissermaßen eine Rückkehr zu meinen Wurzeln.
Die Jahre in Rom, wo ich an der Päpstlichen Universität Gregoriana studierte, am deutsch-ungarischen Kolleg (Germanicum et Hungaricum) bei Jesuiten meine geistliche Formung erhielt und schließlich am Vatikan arbeitete, leben wieder auf. Diese Zeit hat mich geprägt, auch für mein Wirken als Bischof. Ich bin mir sicher, dass ich während der Synode „den Duft der großen, weiten Weltkirche“ täglich einatmen darf. Darauf bin ich gespannt. Ich freue mich.
Die Regelung, dass ein Viertel der annähernd 400 Synodalen nicht zu den Bischöfen gehört und die teilnehmenden Frauen ebenfalls Stimmrecht haben, wurde weltweit mit Interesse begleitet. Wie gravierend schätzen Sie die formalen Neuerungen ein?
Die Neuerungen zeigen, dass Synode nichts Statisches ist, sondern Dynamik hat. Synode ist der gemeinsame Weg, den die Kirche beschreiten will. Ganz neu sind die Änderungen allerdings nicht. Schon auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es weitere Teilnehmer – darunter auch rund 25 Frauen –, die mit ihrer Kompetenz und ihrem theologischen Sachverstand eine wesentliche Rolle spielten und Beschlüsse maßgeblich mit vorbereitet haben. Ich erinnere an Joseph Ratzinger und Karl Rahner.
Wenn jetzt auch Nicht-Bischöfe Stimmrecht haben, dann sollten wir nicht vergessen, dass die Synode kein Entscheidungsgremium ist. Der Papst lässt keinen Zweifel daran, dass er zwar möglichst viele Stimmen hören möchte, dann aber selbst abwägt und nach einer Phase geistlicher Unterscheidung Entscheidungen trifft. Es wird stark von ihm abhängen, was er sich von den Voten zu eigen macht.